Der Aussenseiter
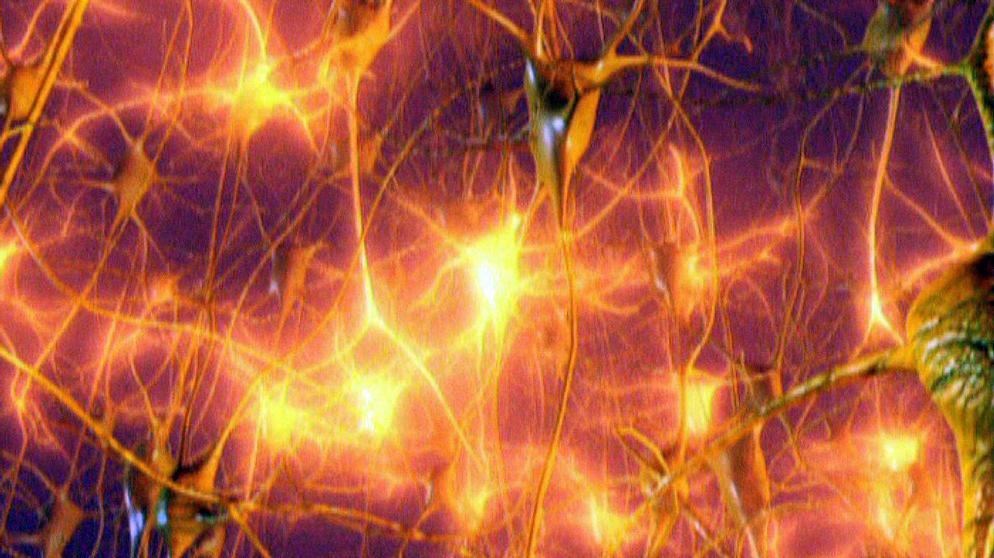
Auszug aus dem zweiunddreissigsten Kapitel
Der Aussenseiter
Gut eineinhalb Wochen später – es war während der Sommerferien 1975 – besuchten wir Mutter in der Klinik im Thurgau. Eingebettet in eine reizvolle Landschaft zwischen den Städten Wil und Winterthur, kümmert sich die Klinik um Menschen, die ihr seelisches Gleichgewicht verloren haben. Auch Mutter sollte dort auf Vordermann gebracht werden, damit sie wieder zu sich selber fände, damit sie dem Alltag mit all seinen Unbilden wieder gewachsen wäre. Unzählige Gespräche mit Ärzten und Psychiatern, viel Ruhe und eine entsprechende Medikation mit Psychopharmaka sollten ihr dabei helfen. Entsprechend ruhig gestellt empfing sie uns dann auch. Sie nahm ein jedes ihrer Kinder in die Arme und liebkoste es. Ihren Ehemann Quinten lächelte sie schüchtern an. Sie sprach nur sehr wenig, erkundigte sich lediglich über dies und das und lächelte immerzu. Die auf ihre Psyche einwirkenden Arzneimittel verfehlten ihre Wirkung nicht und unterdrückten ihre Schmerzen ohne Wunden. Gleichzeitig aber schienen sie aus unserer Mutter ein entrücktes Wesen zu machen, das seine Umwelt nur noch durch den Schleier der Umnachtung wahrnimmt. Ihre Stimme war schwach und leise, ihr Blick glasig und leer. Man konnte ihr ansehen, dass sie noch lange nicht über den Berg sein wird. Während der ersten beiden Wochen wurde sie einer Schlafkur unterzogen. Schon lange litt sie fürchterlich unter Schlaflosigkeit, folglich hatte ihre Seele keine Gelegenheit sich zu erholen. Vielleicht bereiteten ihr ihre ungelebten Träume schlaflose Nächte.
Nach zwei Stunden peinlichen Schweigens verliessen wir die Klinik. Auf dem Weg zum Auto erklärte uns Quinten, dass ein Zusammenbruch nötig gewesen war, ansonsten hätte sich Mutter niemals die richtige Erholung gegönnt, eine Erholung, die Leib und Seele besonders gut tut. Ausserdem sagte er uns, nachdem er sich kurz mit einem der Ärzte unterhalten hatte, dass Mutters Aufenthalt in der Klinik wohl länger dauern würde als angenommen. Man wolle durch eine zu kurze Kur nicht riskieren, dass Mutters Seele einen Rückfall erleiden musste.
Das leuchtete uns ein und wir versicherten Quinten, dass er sich um uns keine Sorgen zu machen bräuchte, wir seien schliesslich keine kleinen Kinder mehr. Am wichtigsten war auf jeden Fall, dass Mutter so lange in der Klinik blieb, wie es die Ärzte für nötig hielten.
Die Ferien waren schneller vorüber, als uns lieb war, und die Schule ging wieder los. In Anbetracht meiner guten schulischen Leistungen waren meine Eltern und mein Klassenlehrer der Meinung, dass man mich entweder aufs Gymnasium oder in die Klosterschule schicken soll. Hätte ich entscheiden können, hätte ich mich für die Kantonsschule entschieden. Meine Eltern aber entschieden sich für die Klosterschule. Es wunderte mich sehr, dass sie mich in das damalige Kapuzinerkloster schickten, war doch Quintens Groll auf den Klerus nach wie vor unvermindert gross.
«Auch wenn ich die Kuttenträger nicht besonders mag, muss ich gestehen, dass sie gute, aber strenge Lehrer sind, Rupert. Bei ihnen wirst du eine Menge lernen. Mehr als an der Kantonsschule. Die drei Jahre sind für dich eine Kleinigkeit, die werden schnell vorüber sein, und dann kannst du immer noch ans Gymnasium.»
«Schon in Ordnung, Paps, dann geh’ ich halt zu den Klosterbrüdern.»
Während der folgenden drei Jahre stieg ich jeweils um sechs Uhr aus den Federn, setzte Kaffeewasser auf, schnitt ein paar Brotscheiben, liess zwei Dreiminuteneier fünf Minuten im köchelnden Wasser und weckte Quinten. Nach dem Frühstück fuhren wir zusammen, meist schweigend, in seinem VW Variant zur Arbeit und zur Schule. Der Unterricht dauerte bis vier Uhr nachmittags, dann folgten zwei quälende Stunden, die wir Schüler – ausnahmslos Jungen – unter strengster Aufsicht mit Studieren im klösterlichen Studiensaal zubrachten. Nach Hause fuhr ich mit der Bahn. Nach dem Abendbrot erledigte ich die Hausaufgaben und ging um punkt neun zu Bett, ausser an Wochenenden und während der Schulferien. Ich bestand darauf, jede Nacht neun Stunden zu schlafen. Mein Tagesablauf folgte einem strengen Zeitplan, den ich unbedingt einhalten wollte. Ich hielt mich strickte an die von mir auferlegten Regeln und erreichte damit nicht nur, in den Genuss von genug wohltuendem Schlaf zu kommen, sondern auch – und das war mir weit wichtiger –, dass die drei Jahre klosterschulischer Drangsal schnell vorübergingen. Im Nachhinein muss ich gestehen, dass mir der Besuch der Klosterschule, die drei Jahre unter klösterlicher Fuchtel, zu keiner Zeit als Katalysator der Selbstfindung diente. Im Gegenteil, an dieser Schule fühlte ich mich fehl am Platz, sie wurde für mich zu keinem Mikrokosmos, den sich Schüler an ihren Schulen erschaffen, um zu dem zu werden, was sie eigentlich schon sind. Diese Schule war für mich zu keiner Zeit ein metaphysischer Schauplatz kulturellen Geschehens, sie war nur eine drei Jahre dauernde Malaise, die mir von meinen Eltern in ihrer fürsorglichen, aber weitsichtigen Blindheit auferlegt wurde. Und das während einer Zeit, in der alles drunter und drüber ging. Trotzdem konnte ich es ihnen nicht übelnehmen.
Unter einer Horde pubertierender Jünglinge, die gerade die Freuden des Masturbierens entdeckten und von nichts anderem sprachen als von Mädchen, Schwänzen, Titten, Vaginas und vom Vögeln, die Tage verbringen zu müssen, passte mir gar nicht in den Kram, stiess mir genau so sauer auf wie der traurige Umstand damals, als ich gegen meinen Willen in den Kindergarten musste. Ständig prahlten die Jungs in der Schule mit ihren Schwänzen, wollten von einander wissen, wie weit sie ihre Ejakulate verspritzen konnten, oder ob man dazu bereit sei, das Geschlechtsteil eines Mädchens zu lecken. Der Klassenprimus erzählte allen, dass er den ganzen Tag über einen Schwarm Fliegen in der Unterhose habe. Sie würden ihm eine Menge Freude bereiten und ihn zu Höchstleistungen anregen. Das alles interessierte mich nicht im Geringsten.
Ich war noch nicht so weit. Meine Gehirnanhangdrüse hatte es anscheinend verpasst dafür zu sorgen, dass in meinem Körper verstärkt Geschlechtshormone produziert werden. Während die hormonelle Veränderung bei meinen Mitschülern zu sichtbarem Muskelwachstum und Körperbehaarung führte, passierte bei mir nichts. Noch nichts. Ich war ein Spätzünder. Mein Muskelaufbau liess sich gehörig Zeit, von Gesichtsbehaarung keine Spur. Nicht dass ich an Verweiblichung litt, auch wenn ich immer wieder für ein Mädchen gehalten wurde. Ich war nun mal von sehr schlanker Natur, trug das Haar leichtgelockt bis auf die Schultern und hatte weiche Gesichtszüge. Heute würde man solche Teenager als androgyn bezeichnen. Damals wunderte ich mich schon sehr, wenn mir beim Friseur die Haare toupiert wurden, oder wenn mich die Lehrer hiessen, zu den Mädchen zu sitzen. Einmal schickten sie mich direkt in die Mädchenklasse. Mehr als zwanzig Mädchen, und mittendrin ich. Das wurde mir eindeutig zu bunt und ich protestierte lautstark, bis die Herrschaften akzeptierten, dass ich ein Junge war und mich in die normale Klasse gehen liessen.
Ihr braucht jetzt nicht zu denken, dass ich als Junge kein Interesse an meinem Schwanz zeigte. Mein Penis entwickelte sich ganz im Gegenteil zum Rest meines Körpers erstaunlich gut. Im erregten Zustand erlangte er eine beachtliche Grösse, und auch ich gab mich ab und an der Selbstbefriedigung hin, auch wenn mein sexuelles Interesse nicht sehr ausgeprägt war. Während andere Jungs in meinem Alter sich vor allem ihren Schwänzen widmeten, mit Pickeln zu kämpfen hatten und erste Annäherungsversuche zum weiblichen Geschlecht wagten, stellte ich mit Genugtuung fest, dass die Pubertät mehr oder weniger sang- und klanglos an mir vorüberzog. Ich verbrachte meine Freizeit damit, zu malen und zu zeichnen, zu lesen und eine Modellbahnanlage zu bauen, eine kleine, perfekte Welt, über die ich herrschen konnte, deren Schöpfer ich war.
Man hätte meinen können, dass ich unbewusst meine Triebe verleugnete und damit genau das verlor, was einem zum Menschen macht. Aber dem war nicht so. Nicht meine Triebe verleugnete ich, sondern vielmehr meine Gefühle. Und diese bedauernswerte Tatsache bedeutete schon früh in meinem Leben, dass ich es schwer haben würde, jemals richtige Gefühle entwickeln zu können. Schon früh verbannte ich meine Emotionen in den Limbus der platonischen Liebe, auch wenn ich mir dessen damals nicht bewusst war.
Gott sei Dank gingen die drei Jahre an der Klosterschule schnell vorüber. Meine Strategie ging auf. Meine Noten waren nach wie vor gut, meine Eltern entsprechend zufrieden. Wenigstens würde es eines ihrer Kinder an die Universität schaffen. Dachten sie. Hofften sie. Aber ich sollte sie bitterbös enttäuschen. Ich schaffte gar nichts. Ich wurde zum Versager. Ich weiss nicht, welcher Teufel mich geritten hat, aber kaum war ich an der Kantonsschule, wurden meine Leistungen schlechter und schlechter. Die Lust, ja die Freude am Lernen waren wie weggefegt. Epigenetisch betrachtet heisst das, dass irgendetwas das für das Lernen zuständige Gen deaktiviert hat. Dafür wurden andere Gene aktiviert. Ich begann zu rauchen, ich begann Alkohol zu trinken und ich begann Interesse am anderen Geschlecht zu zeigen.
Plötzlich an eine Schule zu gehen, an der mehr Mädchen als Jungen waren, bedeutete eine riesengrosse Veränderung für mich. All die hübschen und weniger hübschen Mädchen in engen Jeans, in kurzen Röcken, in langen Röcken, mal offenherzig, mal zugeknöpft, mit grossen Titten, mit kleinen Titten, mit langen Beinen, mit kurzen Beinen, mit breiten Hintern, mit schmalen Hintern, all die Blondinen, Brünetten, Schwarz- und Rothaarigen sorgten bei mir für grosses Staunen und viel Aufregung. Meine Gehirnanhangdrüse holte nach, was sie bisher verschlafen hatte. Ich war überwältigt, wähnte mich in einer Welt paradiesischer Zustände, angefüllt mit Weiblichkeit, Schönheit und Sanftheit. Ich verfiel in einen Zustand libidinöser Umnachtung, wurde jetzt vollends zum Tagträumer. Augenblicklich verknallte ich mich in das Mädchen, in das sich auch alle anderen Jungs verknallten. Und augenblicklich war mir bewusst, dass ich keine Chance bei ihr hatte. Aber das war mir egal. Auch wenn meine Liebe zu ihr nicht erwidert wurde, war das noch lange kein Grund, in Liebeskummer aufzugehen oder andere Jungs zu beneiden, die mehr Erfolg bei ihr hatten. Die Liebe zu ihr war meine Liebe, und die konnte mir niemand wegnehmen. Die Liebe steckt in dem, der liebt, und nicht in der Person, die geliebt wird. Schliesslich führte diese Einstellung zu Mädchen und zur Liebe im Allgemeinen dahin, dass ich mich künftig beinahe ausschliesslich in Mädchen – und später in Frauen – verlieben sollte, bei denen ich mir sicher war und bin, dass sie meine Gefühle nicht erwidern. So behalte ich meine Freiheit und kann doch die Freuden des Verliebtseins geniessen. Ich kann Gefühle für jemanden empfinden, so lange ich will, auch wenn sie zu keiner Zeit erwidert werden.
Natürlich fragte ich mich trotzdem ab und an, warum die Mädchen sich mitunter ausgerechnet die grössten Idioten, die grössten Langweiler oder die grössten Machos aussuchten. Was hatten diese Typen, was ich nicht hatte? Keine Ahnung. Mit der Zeit bereitete es mir grosses Vergnügen zu beobachten, wie Liebschaften entstanden und wieder endeten, um sich alsogleich kopflos in die nächste Beziehung zu stürzen. Da wurden Mädchen innerhalb der Cliquen herumgereicht, und umgekehrt. Und ich stand am Rande des Geschehens und wurde einfach übergangen. Als ob ich nicht da wäre. Zeitlebens hatten die Mädchen mich gerne als Gesellschafter, als Kumpel, aber nicht als Liebhaber, geschweige denn als Freund. Aber das hatte ich mir selber zuzuschreiben. Diese Scheisse habe ich mir selber eingebrockt.
Ich beobachtete das Geschehen wieder einmal vom Rande aus, als Zaungast. Gedankenverloren verfolgte ich diesen Reigen meist oberflächlicher Liebschaften und hatte schon bald das Gefühl, dass die Frau sich während der kurzen Zeit ihrer Blüte möglichst viele Liebhaber, Sexualpartner oder meinetwegen Freunde nimmt, dass Monogamie für sie ein unnatürlicher Zustand ist, dass dieser Zustand ihr zu keiner Zeit reicht, geschweige denn gerecht wird, weil das, was sie zu geben hat, zu viel ist für nur einen Mann. Frauen – und damit vor allem Mädchen – sollen mehrere Männer gleichzeitig haben. Männer hingegen begnügen sich aufs Mal mit einer, sie nehmen sich ihre Frauen nacheinander, weil der Mann mit einer Frau zunächst hilflos überfordert ist, sie ist zu viel für ihn, um dann auf die Dauer dermassen von ihr gelangweilt zu werden – weil sie jetzt zu wenig für ihn ist –, dass er der gemeinschaftlichen Antriebslosigkeit zum Opfer fällt, ohne richtig gelebt zu haben. Also nimmt er sich die Nächste. Die Monogamie ist auf jeden Fall nicht erstrebenswert, weder für die Frau, noch für den Mann. Monogam zu leben bedeutet zu kapitulieren, sich vor den wahren Herausforderungen des Lebens zu drücken, den bequemsten und einfachsten aller Wege zu gehen, auch wenn er der langweiligste, der unbefriedigendste ist. Das mag jetzt klingen wie die Worte eines frustrierten Typen, der bei Frauen keine Chancen hat, aber, und das könnt ihr mir glauben, ich bin nicht frustriert, ich bin nicht gelähmt vor lauter Missmut, und wäre ich frustriert gewesen, wäre ich schon lange ein Gefangener meiner selbst, würde aufgehen in Selbstmitleid, bis ich meiner überdrüssig wäre, und nichts liegt mir ferner, als jemanden zu bemitleiden, weder mich selbst noch sonst jemanden.
Ihr müsst jetzt nicht meinen, dass ich mich am Rande des Rummelplatzes mit dem Augurenlächeln des allzuschlauen Besserwissers nur deshalb herumtrieb, um ein weiteres Mal festzustellen, dass ich ein Ausgestossener war, zu dem mich die Gesellschaft langsam aber sicher machte, nein, zum Aussenseiter habe ich mich selber gemacht, der war ich schon immer, folglich war meine Verwunderung ob all der Begebenheiten und Geschehnisse um mich herum wesentlich geringer, als man hätte erwarten können. Die meisten Menschen, deren Liebe nicht erwidert wird, ertrinken qualvoll im uferlosen Meer der Gefühle. Nicht aber ich. Mit erstaunlicher Gelassenheit fügte ich mich dem Schicksal, auch wenn mir Fortuna nur selten gut gesinnt war.
Nach zwei Stunden peinlichen Schweigens verliessen wir die Klinik. Auf dem Weg zum Auto erklärte uns Quinten, dass ein Zusammenbruch nötig gewesen war, ansonsten hätte sich Mutter niemals die richtige Erholung gegönnt, eine Erholung, die Leib und Seele besonders gut tut. Ausserdem sagte er uns, nachdem er sich kurz mit einem der Ärzte unterhalten hatte, dass Mutters Aufenthalt in der Klinik wohl länger dauern würde als angenommen. Man wolle durch eine zu kurze Kur nicht riskieren, dass Mutters Seele einen Rückfall erleiden musste.
Das leuchtete uns ein und wir versicherten Quinten, dass er sich um uns keine Sorgen zu machen bräuchte, wir seien schliesslich keine kleinen Kinder mehr. Am wichtigsten war auf jeden Fall, dass Mutter so lange in der Klinik blieb, wie es die Ärzte für nötig hielten.
Die Ferien waren schneller vorüber, als uns lieb war, und die Schule ging wieder los. In Anbetracht meiner guten schulischen Leistungen waren meine Eltern und mein Klassenlehrer der Meinung, dass man mich entweder aufs Gymnasium oder in die Klosterschule schicken soll. Hätte ich entscheiden können, hätte ich mich für die Kantonsschule entschieden. Meine Eltern aber entschieden sich für die Klosterschule. Es wunderte mich sehr, dass sie mich in das damalige Kapuzinerkloster schickten, war doch Quintens Groll auf den Klerus nach wie vor unvermindert gross.
«Auch wenn ich die Kuttenträger nicht besonders mag, muss ich gestehen, dass sie gute, aber strenge Lehrer sind, Rupert. Bei ihnen wirst du eine Menge lernen. Mehr als an der Kantonsschule. Die drei Jahre sind für dich eine Kleinigkeit, die werden schnell vorüber sein, und dann kannst du immer noch ans Gymnasium.»
«Schon in Ordnung, Paps, dann geh’ ich halt zu den Klosterbrüdern.»
Während der folgenden drei Jahre stieg ich jeweils um sechs Uhr aus den Federn, setzte Kaffeewasser auf, schnitt ein paar Brotscheiben, liess zwei Dreiminuteneier fünf Minuten im köchelnden Wasser und weckte Quinten. Nach dem Frühstück fuhren wir zusammen, meist schweigend, in seinem VW Variant zur Arbeit und zur Schule. Der Unterricht dauerte bis vier Uhr nachmittags, dann folgten zwei quälende Stunden, die wir Schüler – ausnahmslos Jungen – unter strengster Aufsicht mit Studieren im klösterlichen Studiensaal zubrachten. Nach Hause fuhr ich mit der Bahn. Nach dem Abendbrot erledigte ich die Hausaufgaben und ging um punkt neun zu Bett, ausser an Wochenenden und während der Schulferien. Ich bestand darauf, jede Nacht neun Stunden zu schlafen. Mein Tagesablauf folgte einem strengen Zeitplan, den ich unbedingt einhalten wollte. Ich hielt mich strickte an die von mir auferlegten Regeln und erreichte damit nicht nur, in den Genuss von genug wohltuendem Schlaf zu kommen, sondern auch – und das war mir weit wichtiger –, dass die drei Jahre klosterschulischer Drangsal schnell vorübergingen. Im Nachhinein muss ich gestehen, dass mir der Besuch der Klosterschule, die drei Jahre unter klösterlicher Fuchtel, zu keiner Zeit als Katalysator der Selbstfindung diente. Im Gegenteil, an dieser Schule fühlte ich mich fehl am Platz, sie wurde für mich zu keinem Mikrokosmos, den sich Schüler an ihren Schulen erschaffen, um zu dem zu werden, was sie eigentlich schon sind. Diese Schule war für mich zu keiner Zeit ein metaphysischer Schauplatz kulturellen Geschehens, sie war nur eine drei Jahre dauernde Malaise, die mir von meinen Eltern in ihrer fürsorglichen, aber weitsichtigen Blindheit auferlegt wurde. Und das während einer Zeit, in der alles drunter und drüber ging. Trotzdem konnte ich es ihnen nicht übelnehmen.
Unter einer Horde pubertierender Jünglinge, die gerade die Freuden des Masturbierens entdeckten und von nichts anderem sprachen als von Mädchen, Schwänzen, Titten, Vaginas und vom Vögeln, die Tage verbringen zu müssen, passte mir gar nicht in den Kram, stiess mir genau so sauer auf wie der traurige Umstand damals, als ich gegen meinen Willen in den Kindergarten musste. Ständig prahlten die Jungs in der Schule mit ihren Schwänzen, wollten von einander wissen, wie weit sie ihre Ejakulate verspritzen konnten, oder ob man dazu bereit sei, das Geschlechtsteil eines Mädchens zu lecken. Der Klassenprimus erzählte allen, dass er den ganzen Tag über einen Schwarm Fliegen in der Unterhose habe. Sie würden ihm eine Menge Freude bereiten und ihn zu Höchstleistungen anregen. Das alles interessierte mich nicht im Geringsten.
Ich war noch nicht so weit. Meine Gehirnanhangdrüse hatte es anscheinend verpasst dafür zu sorgen, dass in meinem Körper verstärkt Geschlechtshormone produziert werden. Während die hormonelle Veränderung bei meinen Mitschülern zu sichtbarem Muskelwachstum und Körperbehaarung führte, passierte bei mir nichts. Noch nichts. Ich war ein Spätzünder. Mein Muskelaufbau liess sich gehörig Zeit, von Gesichtsbehaarung keine Spur. Nicht dass ich an Verweiblichung litt, auch wenn ich immer wieder für ein Mädchen gehalten wurde. Ich war nun mal von sehr schlanker Natur, trug das Haar leichtgelockt bis auf die Schultern und hatte weiche Gesichtszüge. Heute würde man solche Teenager als androgyn bezeichnen. Damals wunderte ich mich schon sehr, wenn mir beim Friseur die Haare toupiert wurden, oder wenn mich die Lehrer hiessen, zu den Mädchen zu sitzen. Einmal schickten sie mich direkt in die Mädchenklasse. Mehr als zwanzig Mädchen, und mittendrin ich. Das wurde mir eindeutig zu bunt und ich protestierte lautstark, bis die Herrschaften akzeptierten, dass ich ein Junge war und mich in die normale Klasse gehen liessen.
Ihr braucht jetzt nicht zu denken, dass ich als Junge kein Interesse an meinem Schwanz zeigte. Mein Penis entwickelte sich ganz im Gegenteil zum Rest meines Körpers erstaunlich gut. Im erregten Zustand erlangte er eine beachtliche Grösse, und auch ich gab mich ab und an der Selbstbefriedigung hin, auch wenn mein sexuelles Interesse nicht sehr ausgeprägt war. Während andere Jungs in meinem Alter sich vor allem ihren Schwänzen widmeten, mit Pickeln zu kämpfen hatten und erste Annäherungsversuche zum weiblichen Geschlecht wagten, stellte ich mit Genugtuung fest, dass die Pubertät mehr oder weniger sang- und klanglos an mir vorüberzog. Ich verbrachte meine Freizeit damit, zu malen und zu zeichnen, zu lesen und eine Modellbahnanlage zu bauen, eine kleine, perfekte Welt, über die ich herrschen konnte, deren Schöpfer ich war.
Man hätte meinen können, dass ich unbewusst meine Triebe verleugnete und damit genau das verlor, was einem zum Menschen macht. Aber dem war nicht so. Nicht meine Triebe verleugnete ich, sondern vielmehr meine Gefühle. Und diese bedauernswerte Tatsache bedeutete schon früh in meinem Leben, dass ich es schwer haben würde, jemals richtige Gefühle entwickeln zu können. Schon früh verbannte ich meine Emotionen in den Limbus der platonischen Liebe, auch wenn ich mir dessen damals nicht bewusst war.
Gott sei Dank gingen die drei Jahre an der Klosterschule schnell vorüber. Meine Strategie ging auf. Meine Noten waren nach wie vor gut, meine Eltern entsprechend zufrieden. Wenigstens würde es eines ihrer Kinder an die Universität schaffen. Dachten sie. Hofften sie. Aber ich sollte sie bitterbös enttäuschen. Ich schaffte gar nichts. Ich wurde zum Versager. Ich weiss nicht, welcher Teufel mich geritten hat, aber kaum war ich an der Kantonsschule, wurden meine Leistungen schlechter und schlechter. Die Lust, ja die Freude am Lernen waren wie weggefegt. Epigenetisch betrachtet heisst das, dass irgendetwas das für das Lernen zuständige Gen deaktiviert hat. Dafür wurden andere Gene aktiviert. Ich begann zu rauchen, ich begann Alkohol zu trinken und ich begann Interesse am anderen Geschlecht zu zeigen.
Plötzlich an eine Schule zu gehen, an der mehr Mädchen als Jungen waren, bedeutete eine riesengrosse Veränderung für mich. All die hübschen und weniger hübschen Mädchen in engen Jeans, in kurzen Röcken, in langen Röcken, mal offenherzig, mal zugeknöpft, mit grossen Titten, mit kleinen Titten, mit langen Beinen, mit kurzen Beinen, mit breiten Hintern, mit schmalen Hintern, all die Blondinen, Brünetten, Schwarz- und Rothaarigen sorgten bei mir für grosses Staunen und viel Aufregung. Meine Gehirnanhangdrüse holte nach, was sie bisher verschlafen hatte. Ich war überwältigt, wähnte mich in einer Welt paradiesischer Zustände, angefüllt mit Weiblichkeit, Schönheit und Sanftheit. Ich verfiel in einen Zustand libidinöser Umnachtung, wurde jetzt vollends zum Tagträumer. Augenblicklich verknallte ich mich in das Mädchen, in das sich auch alle anderen Jungs verknallten. Und augenblicklich war mir bewusst, dass ich keine Chance bei ihr hatte. Aber das war mir egal. Auch wenn meine Liebe zu ihr nicht erwidert wurde, war das noch lange kein Grund, in Liebeskummer aufzugehen oder andere Jungs zu beneiden, die mehr Erfolg bei ihr hatten. Die Liebe zu ihr war meine Liebe, und die konnte mir niemand wegnehmen. Die Liebe steckt in dem, der liebt, und nicht in der Person, die geliebt wird. Schliesslich führte diese Einstellung zu Mädchen und zur Liebe im Allgemeinen dahin, dass ich mich künftig beinahe ausschliesslich in Mädchen – und später in Frauen – verlieben sollte, bei denen ich mir sicher war und bin, dass sie meine Gefühle nicht erwidern. So behalte ich meine Freiheit und kann doch die Freuden des Verliebtseins geniessen. Ich kann Gefühle für jemanden empfinden, so lange ich will, auch wenn sie zu keiner Zeit erwidert werden.
Natürlich fragte ich mich trotzdem ab und an, warum die Mädchen sich mitunter ausgerechnet die grössten Idioten, die grössten Langweiler oder die grössten Machos aussuchten. Was hatten diese Typen, was ich nicht hatte? Keine Ahnung. Mit der Zeit bereitete es mir grosses Vergnügen zu beobachten, wie Liebschaften entstanden und wieder endeten, um sich alsogleich kopflos in die nächste Beziehung zu stürzen. Da wurden Mädchen innerhalb der Cliquen herumgereicht, und umgekehrt. Und ich stand am Rande des Geschehens und wurde einfach übergangen. Als ob ich nicht da wäre. Zeitlebens hatten die Mädchen mich gerne als Gesellschafter, als Kumpel, aber nicht als Liebhaber, geschweige denn als Freund. Aber das hatte ich mir selber zuzuschreiben. Diese Scheisse habe ich mir selber eingebrockt.
Ich beobachtete das Geschehen wieder einmal vom Rande aus, als Zaungast. Gedankenverloren verfolgte ich diesen Reigen meist oberflächlicher Liebschaften und hatte schon bald das Gefühl, dass die Frau sich während der kurzen Zeit ihrer Blüte möglichst viele Liebhaber, Sexualpartner oder meinetwegen Freunde nimmt, dass Monogamie für sie ein unnatürlicher Zustand ist, dass dieser Zustand ihr zu keiner Zeit reicht, geschweige denn gerecht wird, weil das, was sie zu geben hat, zu viel ist für nur einen Mann. Frauen – und damit vor allem Mädchen – sollen mehrere Männer gleichzeitig haben. Männer hingegen begnügen sich aufs Mal mit einer, sie nehmen sich ihre Frauen nacheinander, weil der Mann mit einer Frau zunächst hilflos überfordert ist, sie ist zu viel für ihn, um dann auf die Dauer dermassen von ihr gelangweilt zu werden – weil sie jetzt zu wenig für ihn ist –, dass er der gemeinschaftlichen Antriebslosigkeit zum Opfer fällt, ohne richtig gelebt zu haben. Also nimmt er sich die Nächste. Die Monogamie ist auf jeden Fall nicht erstrebenswert, weder für die Frau, noch für den Mann. Monogam zu leben bedeutet zu kapitulieren, sich vor den wahren Herausforderungen des Lebens zu drücken, den bequemsten und einfachsten aller Wege zu gehen, auch wenn er der langweiligste, der unbefriedigendste ist. Das mag jetzt klingen wie die Worte eines frustrierten Typen, der bei Frauen keine Chancen hat, aber, und das könnt ihr mir glauben, ich bin nicht frustriert, ich bin nicht gelähmt vor lauter Missmut, und wäre ich frustriert gewesen, wäre ich schon lange ein Gefangener meiner selbst, würde aufgehen in Selbstmitleid, bis ich meiner überdrüssig wäre, und nichts liegt mir ferner, als jemanden zu bemitleiden, weder mich selbst noch sonst jemanden.
Ihr müsst jetzt nicht meinen, dass ich mich am Rande des Rummelplatzes mit dem Augurenlächeln des allzuschlauen Besserwissers nur deshalb herumtrieb, um ein weiteres Mal festzustellen, dass ich ein Ausgestossener war, zu dem mich die Gesellschaft langsam aber sicher machte, nein, zum Aussenseiter habe ich mich selber gemacht, der war ich schon immer, folglich war meine Verwunderung ob all der Begebenheiten und Geschehnisse um mich herum wesentlich geringer, als man hätte erwarten können. Die meisten Menschen, deren Liebe nicht erwidert wird, ertrinken qualvoll im uferlosen Meer der Gefühle. Nicht aber ich. Mit erstaunlicher Gelassenheit fügte ich mich dem Schicksal, auch wenn mir Fortuna nur selten gut gesinnt war.
